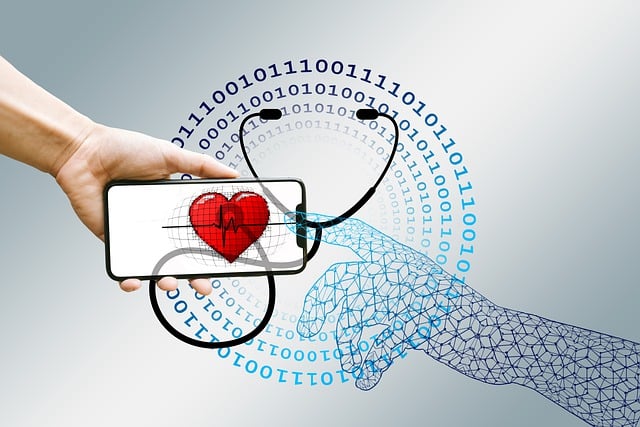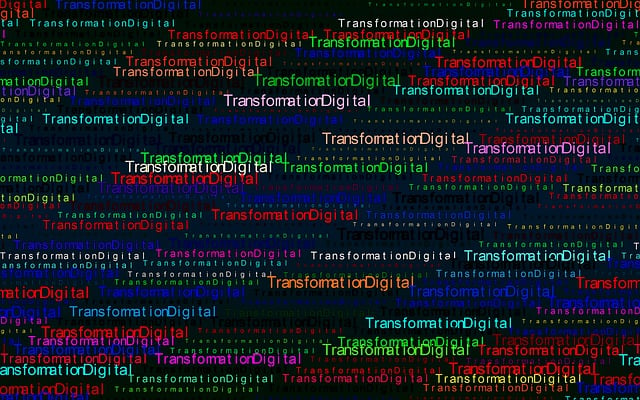Soziale Medien haben das Potenzial, die eigene Körperwahrnehmung und das Essverhalten zu beeinflussen. Teil 1 dieser Beitragsserie „Essstörungen über’s Internet – Der Einfluss der sozialen Medien auf das Ernährungsverhalten“ zeigt allerdings, dass diese nicht allein als Ursache einer Essstörung betrachtet werden können. Vielmehr gelten sie als Mitauslöser oder Verstärker, die an verschiedenen Stellen Wechselwirkungen mit sich ziehen. Doch wie wird mit diesen umgegangen? Was kann man tun, um sich von sozialen Medien nicht zu sehr beeinflussen zu lassen? Wie kann einer Verstärkung des gestörten Essverhaltens durch die Medien entgegengewirkt werden? Und sind Social Media ausschließlich etwas Schlechtes?
Wie wird mit den Wechselwirkungen umgegangen?
Damit soziale Medien erst gar nicht als Verstärker, Mediator oder Mitauslöser einer Essstörung fungieren können, werden je nach Phase präventive Maßnahmen oder Interventionsprogramme angewandt. Diese helfen, potenziell gefährdende Faktoren zu unterbinden und zu beseitigen.[1]
Entstehungsphase:
Die Rolle der sozialen Medien bei Präventionsmaßnahmen
Mit dem Ziel einer adäquaten Selbsteinschätzung haben Menschen das Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten zu vergleichen (Theorie des sozialen Vergleichs).[2] Allerdings werden in den sozialen Medien häufig beschönigte und unrealistische Körperbilder präsentiert. Zur Prävention derartiger Vergleiche besteht in einigen Ländern mittlerweile eine Kennzeichnungspflicht für bearbeitete Bilder. In anderen Ländern wird hingegen innerhalb von Modelagenturen darauf geachtet, dass krankhaftes Untergewicht vermieden wird.[3] Auch auf der Plattform „Pinterest“ erscheinen Warnungen, wenn Nutzer bspw. den Begriff „Thinspiration“ suchen, die u. a. Hinweise auf gesundheitliche Risiken des Ernährungstrends enthalten. Zudem werden auf vielen weiteren Plattformen mittlerweile problematische Inhalte, die eine Selbstgefährdung hervorrufen können, zensiert.[4]
Weiterhin ist es wichtig, möglichst alle Gefährdeten auch in der realen Welt zu erreichen. Da sich Essstörungen häufig im Pubertätsalter manifestieren, kann eine ausgeprägte schulische Aufklärung hilfreich sein.[5] In den Unterricht sollten feste Einheiten integriert werden, die zum Aufbau von Schutzfaktoren (z. B. positives Körperbild, realistische Selbsteinschätzung, Anerkennung verschiedener Lebensformen) dienen.[6] Dünnsein sollte hierbei allerdings nicht mit etwas generell Negativem assoziiert werden. Im Fokus sollte vielmehr die wünschenswerte Bandbreite an Gestalt und Figur stehen. Es geht darum, Individualität und Selbstakzeptanz zu vermitteln. Gleichzeitig ist es wichtig, z. B. mittels Medienkompetenztraining eine kritische Auseinandersetzung mit den aus sozialen Medien übermittelten Botschaften über bestimmte Schönheitsideale hervorzurufen.[7]
Verlaufs- und Bewältigungsphase:
Die Rolle der sozialen Medien bei Interventionsmaßnahmen
Bereits Erkrankten wird häufig geraten, Social Media während einer Therapie zu meiden. Beachtet werden muss hierbei allerdings, dass Essstörungen nicht allein durch soziale Netzwerke hervorgerufen werden, sondern aus einem komplexen Wirkgeschehen, bestehend aus mehreren Faktoren resultieren. Dazu gehören Rahmenbedingungen wie geringes Selbstwertgefühl, Kritik anderer hinsichtlich des eigenen Gewichts, Gefühle der Unzulänglichkeit und des Kontrollverlustes sowie perfektionistisches Denken. Essstörungen werden demnach durch ein Zusammenspiel von psychologischen, sozialen, genetischen und biologischen Faktoren ausgelöst, weshalb das alleinige Meiden von Social Media keine pauschale Lösung darstellt.[8] Auch wenn die Forschung zu den Wechselwirkungen zwischen Social Media und Essstörungen bislang auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, kann festgehalten werden, dass soziale Medien Gruppeneffekte verstärken, was besonders eine potenzielle Gefährdung für junge Nutzer darstellt. Das wiederum resultiert in einer herabgesetzten therapeutischen Heilungschance. Wichtig an dieser Stelle ist deswegen, weniger mit Vermeidungsstrategien zu arbeiten, sondern vielmehr mit Konfrontation bzw. Einbeziehung der sozialen Netzwerke. Somit können individuelle Interaktionen und Gruppenmechanismen analysiert und berücksichtigt werden.[9]
Sind Social Media ausschließlich schlecht?
Wie Teil 1 dieser Beitragsserie zeigt, nutzen viele Erkrankte vorrangig das Medium der sozialen Netzwerke zum Aufrechterhalten der Symptomatik. Es werden Tipps zum Verheimlichen der Krankheit und zum Abnehmen geteilt und das Ausleben der Essstörung befürwortet. Gleichzeitig nutzen einige Erkrankte Social Media auch konstruktiv, z. B. zur Selbstdiagnostik oder Suche nach Informationen und therapeutischer Hilfe.[10] In mehreren Studien zeigt sich ein positiver Einfluss, den soziale Medien haben können. Beispielsweise können Online-Foren von professionellen Organisationen einen geschützten Ort für betroffene Jugendliche darstellen. Somit wird Hilfe leicht zugänglich gemacht und den negativen medialen Einflüssen Widerstand geleistet.[11] Auch alternative Online-Plattformen wie z. B. „Proud2Bme“ bieten Platz für konstruktiven Informations- und Erfahrungsaustausch.[12] Außerdem stellen sich vollständig automatisierte sowie internetbasierte Interventionen als deutlich kostengünstiger und ökonomischer heraus als übliche Therapien. Sie ersetzen diese allerdings nicht vollständig.[13] Online-Communities eignen sich zudem für Angehörige, die Unterstützung und Verständnis suchen.[14]
Fazit
Aus dieser zweiteiligen Beitragsserie geht hervor, dass soziale Medien in Bezug auf Essstörungen eine wichtige Rolle spielen. Sie gelten in der Entstehungsphase als potenzielle Mitauslöser und in der Verlaufs- und Bewältigungsphase als Verstärker.[15] Neben vielfältigen eigeninitiativen Maßnahmen der Plattformbetreiber ist es wichtig, auch außerhalb der sozialen Medien Präventivmaßnahmen einzusetzen. Schulische Briefings, die zum Ziel haben Schutzfaktoren, aufzubauen und Medienkompetenz zu lehren, stellen dabei einen erfolgsversprechenden Lösungsansatz dar.[16] Um Betroffene während des Krankheitsverlaufs optimal unterstützen zu können, stellt es sich als wichtig heraus, Social Media teils in therapeutische Maßnahmen zu integrieren.[17] Betont werden muss, dass soziale Medien ebenfalls positive Effekte aufweisen: Sie bieten mithilfe professioneller Online-Foren Platz für einen konstruktiven Informations- und Erfahrungsaustausch für Betroffene als auch Angehörige.[18]
[1] Vgl. Peter/Brosius (2021), S. 56.
[2] Vgl. Festinger (1954), S. 138.
[3] Vgl. Peter/Brosius (2021), S. 56.
[4] Vgl. Zielinski (2016), S. 153.
[5] Vgl. Karwautz/Wagner (2008), S. 172.
[6] Vgl. Eisenmann et al. (2017), S. 12.
[7] Vgl. Karwautz/Wagner (2008), S. 171; Peter/Brosius (2021), S. 60.
[8] Vgl. Zielinski (2016), S 153.
[9] Vgl. Zielinski (2016), S 153.
[10] Vgl. Peter/Brosius (2021), S. 57-58.
[11] Vgl. Kendal et al. (2017), S. 107-108.
[12] Vgl. Aardoom et al. (2014), S. 350.
[13] Vgl. Aardoom et al. (2016), S. 1071-1075.
[14] Vgl. LaMarre et al. (2015), S. 391-393.
[15] Vgl. Baumann/Harden/Scherer (2003), S. 424.
[16] Vgl. Eisenmann et al. (2017), S. 12; Karwautz/Wagner (2008), S. 171; Peter/Brosius (2021), S. 60.
[17] Vgl. Zielinski (2016), S 153.
[18] Vgl. Peter/Brosius (2021), S. 57-58; Kendal et al. (2017), S. 107-108; LaMarre et al. (2015), S. 391-393.
Literatur
Aardoom, J. J./Dingemans, A. E./Boogaard, L. H./Van Furth, E. F. (2014), Internet and patient empowerment in individuals with symptoms of an eating disorder: A cross-sectional investigation of a pro-recovery focused e-community, Eating behaviors, 15. Jg., Nr. 3, S. 350-356.
Aardoom, J. J., Dingemans, A. E., van Ginkel, J. R., Spinhoven, P., van Furth, E. F. & van den Akker-van Marle, M. E.(2016). Costutility of an internet-based intervention with or without therapist support in comparison with a waiting list for individuals with eating disorder symptoms: a randomized controlled trial, The International journal of eating disorders, 49. Jg., Nr. 12, S. 1068–1076.
Baumann, E./Harden, L./Scherer, H. (2003), Zwischen Promi-Tick und Gen-Defekt, Zur Darstellung von Essstörungen in der Presse, M&K Medien & Kommunikationswissenschaft, 51. Jg., Nr. 3-4, S. 431-454.
Eisenmann, A./Fröschl, B./Stürzlinger, H./Wimmer-Puchinger, B./Grabenhofer-Eggerth, A. (2017), Wirksamkeit und Effizienz von Maßnahmen zur Primärprävention von Essstörungen, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.), Schriftenreihe: Health Technology Assessment, Bd. 136, Köln.
Festinger, L. (1954), A theory of social comparison processes, Human relations, 7. Jg., Nr. 2, S. 117-140.
Karwautz, A./Wagner, G. (2008), Prävention der Essstörungen. In: Herpertz, S./de Zwaan, M./Zipfel, S. (Hrsg.), Handbuch Essstörungen und Adipositas, Heidelberg, S. 170-175.
Kendal, S./Kirk, S./Elvey, R./Catchpole, R./Pryjmachuk, S. (2017), How a moderated online discussion forum facilitates support for young people with eating disorders, Health Expectations, 20. Jg., Nr. 1, S. 98-111.
LaMarre, A./Robson, J./Dawczyk, A. (2015), Mothers’ Use of Blogs While Engaged in Family-Based Treatment for a Child’s Eating Disorder, Families, Systems & Health: the journal of collaborative family healthcare, 33. Jg., Nr. 4, S. 390-394.
Peter, C./Brosius, H.-B. (2021), Die Rolle der Medien bei Entstehung, Verlauf und Bewältigung von Essstörungen. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz, 64. Jg., Nr. 1, S. 55–61.
Zielinksi, J. (2016), Wie wirken Social Media auf das Ernährungsverhalten?, Ernährung & Medizin, 31. Jg., Nr. 4, S. 152-155.
Bildquelle (Titelbild)
Ott, C. (2020), https://unsplash.com/photos/hgGLolfrGyQ, online abgerufen am 28.06.2021.