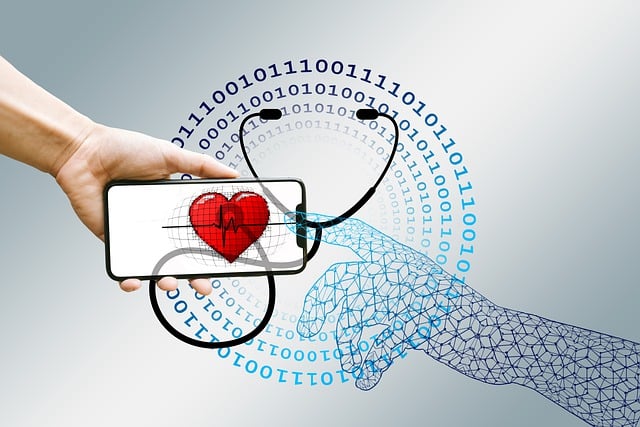Häufig wird man schräg von der Seite angeschaut, wenn man sich als Psychologiestudent „outet“. Neben Superkräften wie einem Röntgenblick für die Seele oder einer Sofort-Heilpower für allerlei psychische Störungen, werden auch schon angehenden Psychologen obskure hellseherische Fähigkeiten angedichtet. Allerdings ranken sich auch weit weniger übersinnliche Mythen um den Psychologiestudenten im Allgemeinen. Beispielsweise ein ausgeprägter Helferkomplex oder die Möglichkeit den eigenen psychischen Knacks zu kurieren, um nur zwei der typischen Klischees zu nennen. Doch woher stammt nur dieses stereotypisierte Denken?
Wenn wir die Gründe für das Verhalten der anderen verstehen könnten, würde plötzlich alles einen Sinn ergeben.
(Sigmund Freud, 1856-1939, Psychiater)
In der modernen Leistungsgesellschaft werden psychische Erkrankungen wie Depression, Angststörung oder Belastungsstörungen immer noch als Stigma betrachtet.[1] Demgegenüber bestehen Berührungsängste mit der Berufsgruppe der Psychologen und dem offenen Umgang mit der Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Angeboten.[2] Ebendiese Problematik in Kombination mit einer weit verbreiteten Unwissenheit um Studien- und Berufsinhalte führen zu Vorurteilen und vorgefassten Meinungen.
Das Vorurteil ist das Kind der Unwissenheit.
(William Hazlitt, 1778-1830, brit. Schriftsteller)
Bereits in Untersuchungen von 1974 galten Studierende der Psychologie als hypothetische ‚Negativauslese‘. Jedoch zeigten sich im direkten Vergleich zu Studenten anderer Fächer keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Angst, Anspannung und Neurosen.[3] Die sich zwangsläufig stellende Frage lautet daher, ob Psychologiestudenten in ihrer Persönlichkeit wirklich deutlich von der Norm abweichen und die dominierenden Klischees, sowie Stereotype einen reellen Wirklichkeitsanspruch genießen.
Laut Sydow (2007) besteht für Vertreter der Fachrichtung Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie ein stark stereotypisiertes Fremdbild, welches äußerlich maskulin geprägt ist und eine schwerpunktmäßige Ausrichtung hinsichtlich der Psychoanalyse besitzt. Darüber hinaus differenziert sich der Vorstellungstyp weiterhin in drei verbreitete Ausprägungsformen, nämlich den hilflosen Neurotiker, dem gegenüber in starkem Widerspruch der sexuell, narzisstische oder sogar finanziell gefährdende Missbraucher steht. Den Dritten im Bunde spiegelt der kompetente, warme und intellektuelle Elterntyp wieder.[4] Nimmt man dieses breitgefächerte Spektrum „vom Jammerlappen bis zum Verbrecher“ als bare Münze hin, zeichnet sich ein Bild ab, welches das klischeebehaftete Denken der Gesellschaft sichtlich unterstützt. Im Gegensatz dazu, besitzen Psychologen selbst ein recht positiv zu bewertendes Selbstbild, wodurch sich die Diskrepanz im Hinblick auf das Image noch verstärkt.[5]
Insgesamt zeigt sich aber eine sehr dünne Untersuchungsbasis bezüglich der spezifischen Persönlichkeitsstruktur von angehenden Psychologen, mangels Vergleichbarkeit der Studienfächer bzw. Verallgemeinerung der erzielten Forschungsergebnisse.[6] Auf Grund dessen, untersuchte die Arbeitsgruppe um King et al. (2004) eine größere Anzahl an Persönlichkeitsprofilen von US-amerikanischen Studenten (84 Psychologie/ 458 andere) über 34 psychosoziale Variablen (bspw. Depression, Missbrauch, Gewalt) hinsichtlich der Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Des Weiteren unterzogen McCray et al. (2005) die zuvor erzielten Ergebnisse der Arbeitsgruppe um King einer weiterführenden Analyse mittels Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2). Beide Studien konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf die Persönlichkeitsprofile der Studenten feststellen.[7] Im deutschsprachigen Raum fand eine ähnliche Vergleichsstudie (2014) mit Fokus auf Studenten der Psychologie und der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften), unter Verwendung eines Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventars (PSSI), statt. Hier wiesen die PSSI-Profile der Studenten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede auf, zusätzlich konnten hierbei keine Auffälligkeiten der Profildiagramme bezüglich des klinischen Bereichs festgestellt werden.[8]
Ein Aspekt kristallisiert sich während der Recherche allerdings deutlich heraus, Studierende der Psychologie sind durch ihr Vorwissen und einer daraus resultierenden Bereitschaft, schneller um die Behandlung bestehender psychischer Probleme bemüht.[9] Grundsätzlich ist jedoch für Studenten unabhängig ihres Faches, ein deutlicher Anstieg an psychologischen und psychosomatischen Belastungen zu verzeichnen.[10]
Wenn nunmehr auf Basis der genannten Quellen von keinen außergewöhnlichen Persönlichkeitsfaktoren gesprochen werden kann, wieso entscheiden sich Studierende also für das Fach Psychologie? Neben allgemeingültigen Aspekten wie dem rein fachlichen Interesse, empfiehlt es sich ein gutes Methodenverständnis, sowie Freude im Umgang mit Statistiken und vor allem englischer Fachliteratur zu haben. Darüber hinaus sollte ebenfalls Mut zum kritischen Denken und der Erweiterung der persönlichen Perspektive bestehen. Diese umfasst beispielsweise die Verbesserung der eigenen Kommunikationsfähigkeit, sowie die leichtere Bewältigung von bestehenden Problemen. Des Weiteren kann jeder Student noch differenziertere persönliche Faktoren einbringen, die ihn zur Wahl ‚Psychologie‘ veranlasst haben.
Selbst wenn das ultimative Ziel nicht ganz erreichbar ist, werden wir bessere Menschen, wenn wir versuchen, ein höheres Ziel zu verfolgen.
(Viktor Frankl, 1905-1997, österr. Neurologe und Psychiater)
Einer Studie nach Hofmann und Stiksrud (1993) zufolge gaben 69 %, von 96 teilnehmenden Studienanfänger der Fachrichtung Psychologie an, dass sie auf Grund des Motivs „persönlich und beruflich helfen zu können“ ihre Studienfachwahl getroffen haben. Darüber hinaus stimmten jeweils mehr als 40 Prozent der Befragten damit überein, zum einen „Menschenkenntnis gewinnen“ zu wollen und zum anderen ein „subjektiv-persönliches Interesse“ zu besitzen. Allerdings darf auch nicht unter den Tisch fallen gelassen werden, dass ebenfalls 18 Prozent der Probanden persönliche Probleme als Basis für ihre Motivation angegeben haben.[11]
Zusammenfassend zeigen die angeführten Studien keinen signifikanten ‚Knacks‘ in der Persönlichkeitsstruktur der untersuchten Psychologiestudenten, jedoch spricht dies natürlich nicht automatisch einen jeden Studenten hiervon frei. Vor allem wenn man sich den Fakt der stetig steigenden Zahlen an psychischen Erkrankungen, unter Studenten, vor Augen hält. Trotz der Untersuchungsergebnisse werden die bestehenden Klischees und Stereotypen nicht einfach aus der Gesellschaft verschwinden. Allerdings kann jeder Psychologiestudierende oder in diesem Sektor Tätige seinen Beitrag leisten, um als positives Beispiel und Vorbild zu agieren, damit ebendiese negativen Vorurteile abgeschwächt werden.
[1] Rüsch, N.: 2010.
[2] Angermeyer, M.C./ Hozinger, A.: 2005.
[3] Jansen, J.-P./ Gabler, H.: 1974.
[4] Von Sydow, K.: 2007. 326f.
[5] Wahl, S/ Rietz, I.: 1999.
[6] Naydenova, I./ Lounsbury, J. W./Levy, J. J./ Kim, J.: 2012.
[7] King, A. R./ Bailly, M. D./ Moe, B. K.: 2004. und McCray, J. A./ Bailly, M. D./ King, A. R.: 2005.
[8] Bochter, B./ Hagl, M./ Piesbergen, C./ Peter, B.: 2014.
[9] Holm-Hadulla, R. M./ Soeder, U.: 1997.
[10] Holm-Hadulla, R. M./ Hofmann, F.-H./ Sperth, M/ Funke, J.: 2009.
[11] Hofmann, H./ Stiksrud, A.: 1993.
Titelbild zu „Und was machst du so? Aufräumen mit Mythen über das Psychologiestudium“
Eigene Darstellung aus den Quellen:
https://pixabay.com/de/illustrations/superhelden-m%C3%A4dchen-geschwindigkeit-534120/
https://pixabay.com/de/photos/orakel-m%C3%A4dchen-fotomontage-hexe-2133976/
https://pixabay.com/de/illustrations/k%C3%BCnstliche-intelligenz-gehirn-hirn-3382507/
Literatur zu „Und was machst du so? Aufräumen mit Mythen über das Psychologiestudium“
Angermeyer, M.C./ Breier, P./ Dietrich, S./ Kenzine, D./ Matschinger, H.: Public attitudes toward psychiatric treatment. An international comparison. Soc Psychiat Epidemiol 40. Springer. 2005. 855-864.
Bochter, B./ Hagl, M./ Piesbergen, C./ Peter, B.: Persönlichkeitsstile von Psychologiestudierenden im Vergleich zu Studierenden sogenannter MINT-Fächer. Report Psychologie. 4. 2014. 154-165.
Hofmann, H./ Stiksrud, A.: Wege und Umwege zum Studium der Psychologie III. Psychologische Rundschau. 44. 1993. 250-256.
Holm-Hadulla, R. M./ Soeder, U.: Psychische Störungen von Studierenden. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie. 47. 1997. 419-425.
Holm-Hadulla, R. M./ Hofmann, F.-H./ Sperth, M./ Funke, J.: Psychische Beschwerden und Störungen von Studierenden. Psychotherapeut. 54. 2009. 346-356.
Janssen, J.-P./ Gabler, H.: Sind Psychologiestudenten unter Studienanfängern eine „Negativauslese“? Eine psychometrische Untersuchung der Persönlichkeitsstruktur erstsemestriger Psychologiestudenten der Universität Tübingen im Studienjahr 1971. Psychologische Rundschau. 25. 1974. 275-293.
King, A. R./ Bailly, M. D./ Moe, B. K.: External validity considerations regarding college participant samples comprised substantially of psychology majors. In: Shohov, S. P. (Hrsg.): Advances in psychology research, Vol 29. Hauppage. NY: Nova Science Publisher. 2004.71-85.
McCray, J. A./ Bailly, M. D./ King, A. R.: The external validity of MMPI-2 research conducted using college samples disproportionately represented by psychology majors. Personality and Individual Differences. 38. 2005. 1097-1105.
Naydenova, I./ Lounsbury, J. W./ Levy, J. J./ Kim, J.: Distinctive Big Five and narrow personality traits of psychology majors. Individual Differences Research. 10. 2012. 129-140.
Rüsch, N.: Reaktion auf das Stigma psychischer Erkrankung. Soziopsychologische Modelle und empirische befunde. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie. Vol.58. Issue 4. 2010. 287-297
Von Sydow, K.: Das Image von Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern in der Öffentlichkeit. Ein systematischer Forschungsüberblick. Psychotherpeut. 52. 2007. 322-333.
Wahl, S./ Rietz, I.: PsychologInnen in der Öffentlichkeit – Selbstbild, Fremdbild und vermutetes Fremdbild. In Rietz, I./ Kliche, T./ Wahl, S. (Hrsg.): Das Image der Psychologie. Empirie und Perspektiven zur Fachentwicklung. Lengerich-Papst Science Publisher. 1999. 40-64.