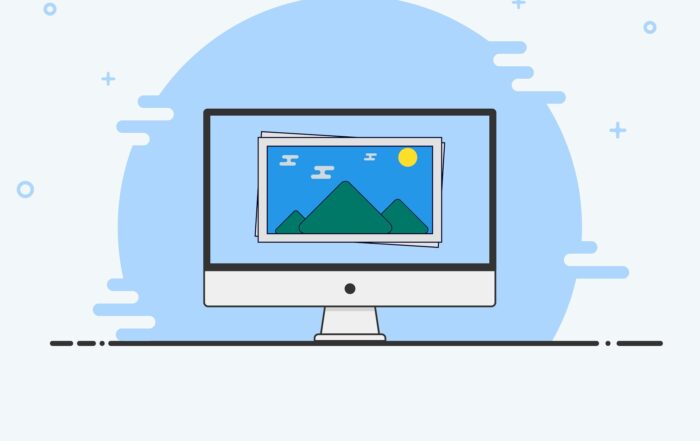Geschlechtsunterschiede und -gemeinsamkeiten von Emotionen
Frauen bzw. weiblich gelesene Personen werden in unserer Gesellschaft meist eine hohe Emotionalität zugeschrieben. Dies ergab auch eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2001, bei dem 90 % der Befragten der Meinung waren, dass das Attribut „emotional“ eher in Bezug auf Frauen stimme. Diese Behauptung ist bei aller Aktualität bis auf 2300 Jahre zurückzuführen, wie Aufzeichnungen von Aristoteles es belegen. Der Philosoph Artistoteles beschreibt Frauen als weniger mutig im Vergleich zu Männern und gleichzeitig als weicher und mitfühlender. Zusätzlich seien Frauen eher zu Tränen geneigt, gleichzeitig aber neidischer, eher zum streiten aufgelegt, schamloser und betrügerischer. Der allgemeinen Annahme nach weinen Frauen viel mehr, sind schnell gereizt und sogar hysterisch. Mit weiblich und emotional werden im gleichen Zuge auch andere Eigenschaften wie „irrational“ und „sensibler“ angeführt.
Männer bzw. männlich gelesene Personen werden hingehen als rational beschrieben, was ebenfalls bis heute einen überwiegenden Teil der männliche Identität beschreibt. In einer Studie aus dem Jahr 2012 von Else-Quest, Higgins, Allison & Morton konnte allerdings nachgewiesen werden, dass das Emotionserleben für beide Geschlechter gleich ist. Frauen drücken lediglich ihre Gefühle mehr aus, als das dies Männer machen. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die Umstände bzw. die Situationen, in denen sich die Personen befinden. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass Frauen emotionaler reagieren, wenn man dies ihnen vorgibt bzw. sie mit diesem weiblichen Stereotyp konfrontiert. Das Gefühlserleben von Frauen kann demnach, zumindest vereinzelt, als selbsterfüllende Prophezeiung bezeichnet werden (Van Boven & Robinson, 2012).

Bild 1: Frau und Mann
Geschlechtsspezifische Normen prägen den Ausdruck von Gefühlen
Die Frage, warum Frauen eine höhere Emotionalität zugeschrieben wird bzw. diese auch vermehrt zum Ausdruck bringen, kann auf Geschlechtsprägungen bzw. geschlechtsspezifischen Normen zurückgeführt werden. Frauen und Männer werden beide in ihrem Zeigen von Emotionen im Rahmen ihrer Erwartungen an die Geschlechter geprägt. Da das Erleben von Emotionen, wie bereits angeführt, unabhängig der Geschlechter ist, kann nach genauerer Betrachtung die Emotionsregulation als Ursache angeführt werden. Diese unterliegt geschlechtsspezifischen Normen. Das bedeutet, dass ein Mann durch soziale Normen wie beispielsweise „Männer weinen nicht“ dazu neigt, bei Traurigkeit sein Gefühlserleben zu unterdrücken.
Emotionsregulation per Definition nach Gross (2002) beinhaltet alle Prozesse, die uns ermöglichen, Einfluss darauf auszuüben, welche Emotionen wir haben, wann wir diese haben und wie wir diese erleben und dahingehend auch zum Ausdruck bringen. Ein zentraler Aspekt der Emotionsregulation umfasst die Versuche, unerwünschte Emotionen zu unterdrücken oder zu vermindern, während auf der anderen Seite Bestrebungen angestellt werden, erwünschte Emotionen zu intensivieren oder entstehen zu lassen. Um die Wirkungsweise von Emotionsregulation nachvollziehen zu können, wird an dieser Stelle die Motivation dahinter angeführt. Neben hedonistischen Motiven, negative affektive Zustände vermeiden, positive aufrecht zu erhalten, liegt eine soziale Motivation dahinter. Der Ausdruck und die Regulation von Emotionen findet immer in einem sozialen Rahmen statt, indem soziale Ziele verfolgt werden.
Motive als soziale Ziele bilden den Ausgangspunkt
Drei Motivtypen können in Bezug auf die sozialen Ziele angeführt werden. Hierzu zählt unteranderen die Steuerung des Eindrucks, den andere Personen von uns haben sollen. Des Weiteren kann die Regulation von Emotionen prosozial motiviert sein. Generell ist der Mensch dazu bestrebt, seine Mitmenschen zu beschützen und sie zufrieden zu stellen bzw. ihnen nicht zu schaden. Zusätzlich können wir mit der Emotionsregulation Einfluss auf das Verhalten von anderen ausüben. Eine starke Gefühlsreaktion kann beispielsweise mit dem Bestreben nach Aufmerksamkeit einhergehen.
Soziale Identitäten formen den Gefühlsausdrücke
Es wird angenommen, dass die Normen mit den sozialen Identitäten und die Rollen der Geschlechter in Beziehung stehen. Bislang bestimmen die traditionellen, sozialen Rollen die Emotionsregulation von Frauen und Männern. Dabei ist die Rolle von Frauen so geprägt, dass diese vorallem positive und „machtlose“ Emotionen zeigen. Frauen werden darin bestärkt, Gefühlen wie Scham, Schuld oder Trauer zu zeigen. Hinsichtlich Funktionalität ist die ausgeprägte Emotionalität auf die klassische Frauenrolle zurückzuführen, welche vorallem die fürsorgliche, auf Beziehungserhalt ausgerichtete Rolle, umfasst.
Gegensätzlich dazu führt die traditionelle soziale Rolle von Männern dazu, dass diese vorallem weniger und gleichzeitig machtvolle Emotionen zeigen. Ebenso wie bei Frauen ist dies auch auf die klassische Rollenerwartung zurückzuführen. Diese gibt vor, dass der Mann seine Gefühle unterdrücken und rational handeln soll. Ein starker Ausdruck von Emotionen wird im Zuge der klassischen Rollenerwartung an Männern als Schwäche bezeichnet und entsprechende negative Konsequenzen würden dahingehend folgen. Emotionen wie Ärger, Wut und Verachtung gelten als machtvoll und sind somit Teil der klassischen Rollenerwartung.
Dies hat zur Folge, dass Frauen bestrebt sind, machtbezogenen Emotionen zu unterdrücken bzw. abzuschwächen, während Männer eher machtlose Emotionen sie so regulieren, sie nicht zu zeigen oder abzuschwächen.
Klassische soziale Identitäten schaffen Ungleichheit
Dieses Fundament der weiblichen und männlichen Identität, welche beschrieben wurde, führt im 21. Jahrhundert im Zuge der Gleichstellung bzw. Gleichheit der Geschlechter zu starken Schwierigkeiten. Vorallem das Herunterbrechen von weiblich/männlich bzw. emotional/rational führt zu der Schlussfolgerung und gleichzeitig Problematik, dass emotional als Ergänzung „irrational“ mit umfasst. Des Weiteren sind wir in unserer Gesellschaft mit der Gleichstellung der Geschlechter dahingehend angekommen, dass bestimmte Eigenschaften nicht mehr einem Geschlecht zugeordnet werden, da so bestimmte Tätigkeiten auch geschlechtsspezifisch sind. Ein Beispiel, welches dies sehr verdeutlich, ist die Care-Arbeit bzw. die Fürsorgearbeit bei Kindern. Eine Gleichstellung beider Geschlechter ist nur dann zu erwarten, wenn auch Männern frei von Erwartungen der Emotionregulation sich fürsorglich gegenüber ihren Kindern zeigen können. Frauen hingehend als das ausschließlich emotionale Geschlecht zu bezeichnen ist daher unangebracht und kontraproduktiv.
Fazit und Ausblick
Ein Weg weg von der Polarität der Geschlechter zeichnet sich langsam aber zunehmend in unserer Gesellschaft ab, indem emotional authentisches Verhalten gefordert wird. In sozialen Interaktionen sollen die wahren Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Demnach führt eine aufkommende „Emotionalisierung der westlichen Gesellschaft“ zu einer Abschwächung der noch aktuell vorherschenden geschlechtsspezifischen Normen. Eine wirkliche Gleichstellung aller Geschlechter ist nur dann vorhanden, wenn auch die geschlechtsspezifischen Erwartungen, wie hier an die Emotionen, somit verschwinden.
Literaturverzeichnis:
Barrett, L. F. & Bliss-Moreau, E. (2009). She’s emotional. He’s having a bad day: Attributional explanations for emotion stereotypes. Emotion, 9(5), S. 649-658 doi: 10.1037/a0016821
Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M. & Lozo, L. (2018). Motivation und Emotion – Allgemeine Psychologie für Bachelor (1. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag doi: 10.1007/978-3-662-56685-5
Debold, E. (2023). Rationale Männer, emotionale Frauen – Über Mythen, die unser Leben bestimmen. Zugriff am 22.05.2023. Verfügbar unter https://www.evolve-magazin.de/magazin-archiv/ausgabe-02-2014/elizabeth-debold-rationale-maenner-emotionale-frauen/
Else-Quest, N. M., Higgins, A., Allisson, C., & Morton, L. C. (2012). Gender differences in self-conscious emotional experience: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 138(5), S. 947-981 doi: 10.1037/a0027930
Shields, S. A. (2002). Speaking from the heart: Gender and the social meaning of emotion. Cambridge University Press
Van Boven, L. & Robinson, M. D. (2011). Boys don’t cry: Cognitive load and priming increase stereotypic sex differences in emotion memory. Journal of Experimental Social Psychology, 48, S. 303-309 doi: 10.1016/j.jesp.2011.09.005
Bildnachweis Bild 1:
https://pixabay.com/de/photos/mann-frau-composing-streit-2933991/
Bildnachweis Titelbild:
https://pixabay.com/de/photos/portr%C3%A4t-junge-frau-blond-augen-2041186/